Kirche im Wandel – Warum Schrumpfen nicht das Ende sein muss
Die Kirche erlebt eine Zeitenwende. Mitgliederzahlen sinken, gesellschaftliche Erwartungen verändern sich, und die Digitalisierung stellt neue Herausforderungen. Pfarrer Klaus Künhaupt spricht über den Wandel, die Probleme und neue Wege in die Zukunft.
„Früher ist das Interesse an der Kirche auch nicht größer gewesen“, sagt Klaus Künhaupt, Pfarrer der evangelischen Erlöserkirchengemeinde in Essen Holsterhausen, als er über den Wandel der zurückliegenden Jahrzehnte spricht. Trotzdem steht die Kirche heute unter immensem Druck. Kirchenaustritte sind auf einem Höchststand und die gesellschaftliche Rolle der Institution wird hinterfragt. Doch ist das wirklich ein Zeichen des Niedergangs oder vielmehr ein Umbruch?
von Nina Pothmann
03. Juli 2025
Journalistische und auftragsorientierte Texte

Klaus Künhaupt, Pfarrer der Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen in Essen in seinem Büro
Klaus Künhaupts Weg zur Kirche
Klaus Künhaupt, geboren am 16. August 1970 in Essen, wuchs in einem kirchlich geprägten Umfeld auf. Sein Vater war Pfarrer an der Zionskirche in Essen Horst, seine Mutter engagierte sich aktiv in der Frauenhilfe. Schon früh kam er mit dem Gemeindeleben in Berührung – ob als Kind im Kindergottesdienst oder als Jugendlicher bei Jugendtreffangeboten. „Meine ersten Erinnerungen sind verknüpft mit Kindergottesdienst, mit Kinderchor, mit meinen drei älteren Schwestern“, erzählt Künhaupt.
Doch sein Weg in die Theologie war nicht vorgezeichnet. Nach dem Abitur studierte er zunächst Islamwissenschaft in Hamburg. Er erinnert sich an eine Szene, in der er durch Hamburg, weit weg vom Elternhaus, lief und dachte: „Vielleicht bist du ja Atheist?“ Doch als er sich ernsthaft fragte, ob er sich als nichtgläubig bezeichnen könnte, spürte er eine Leere, eine Verlorenheit. Er wusste: „Das wirst du nie, nie, nie sagen können. Da habe ich entschlossen: Nein, dann gehörst du auch dazu.“
Aber erst nach dem Tod seines Vaters einige Jahre später wechselte er zur evangelischen Theologie und fand darin seine Berufung. Heute ist er Pfarrer der Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen und setzt sich aktiv für eine Kirche ein, die sich den Herausforderungen der Zeit stellt.
Warum Glaube heute kein Automatismus mehr ist
Die Zahl der Kirchenaustritte steigt stetig. 2022 verließen laut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) über 380.000 Menschen die evangelische Kirche. Doch Künhaupt glaubt nicht, dass das Interesse an Religion grundsätzlich abgenommen hat. „Das Interesse an Kirche bei den Menschen in meinem Alter in den 1980er-Jahren war auch gleich null, muss man klar sagen.“ Jugendliche hätten sich damals ebenfalls kaum für biblische Themen interessiert.
Der Unterschied zu heute? Früher seien die Leute trotzdem geblieben – aus Tradition, aus einem Gefühl der Zugehörigkeit, weil es normal war. „Sie haben ihre Kirchensteuer bezahlt, weil man das so machte oder auch, weil man dachte, man tut ja auch was Gutes damit“, erklärt Künhaupt. Heute hinterfragen viele das. Und wenn die Leute nicht unmittelbar einen persönlichen Nutzen oder eine Bedeutung darin sehen, treten sie aus.
Das sei besonders bei jungen Erwachsenen spürbar: Solange sie noch studieren, machen sie sich darüber kaum Gedanken. Doch sobald sie das erste Mal Geld verdienen und einen Blick auf ihren Lohnzettel werfen, auf dem 50 € Kirchensteuer stehen, fragen sie sich: „Brauche ich das wirklich?“

Frau alleine in der leeren Erlöserkirche in Essen samstags zur „Offenen Kirche“
Warum kaum jemand zurückkehrt
Statistiken zeigen: Vor allem Jüngere verlassen die Kirche. 46 Prozent der katholischen und 49 Prozent der evangelischen Ausgetretenen sind zwischen 18 und 35 Jahren alt. Dahingegen waren nur 9 Prozent der katholischen und 11 Prozent der evangelischen Ausgetretenen 60 Jahre oder älter.
Für viele spielt Religion einfach keine Rolle mehr und hat demnach keinen Platz als zentraler Bestandteil ihres Lebens. Besonders in Großstädten zeigt sich ein deutlicher Trend zur Säkularisierung.
Während immer mehr Menschen austreten, gibt es kaum Wiedereintritte. 2022 traten im Erzbistum Paderborn 26.911 Menschen aus, aber nur 164 kehrten zurück. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Menschen gehen – und sie kommen nicht wieder. Die Kirche steht somit vor der Herausforderung, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen und den Menschen neue Anknüpfungspunkte zu bieten.
Warum die Kirche an Vertrauen verliert
Jahr für Jahr kehren hunderttausende Menschen der Kirche den Rücken. Die Gründe sind vielschichtig – von finanziellen Belastungen bis hin zu ethischen Fragen. Doch was bewegt die Austretenden wirklich? Und gibt es eine Chance zur Rückkehr?
Der häufigste Grund für den Kirchenaustritt ist die Kirchensteuer – 62 Prozent der ehemaligen Katholiken geben dies als Hauptgrund an. Weitere 47 Prozent nennen die Missbrauchsskandale als ausschlaggebend für ihren Austritt. Hinzu kommen Themen wie der Umgang mit Frauen (40 Prozent) oder der LGBTQ-Community (20 Prozent). Das Vertrauen in die Institution leidet und die Kirche erscheint vielen als nicht mehr zeitgemäß.
Doch oft geht es um mehr. Dinge wie die Kirchensteuer sind für viele nur der letzte Auslöser einer längeren Entfremdung und bereits länger bestehenden Austrittsgedanken. Konkrete Anlässe wie der Missbrauchsskandal oder der Umgang mit bestimmten Themen sind dann oft nur der letzte Tropfen, der das Fass sprichwörtlich zum Überlaufen bringt.

Außenansicht der Erlöserkirche Essen, „Offene Kirche“ am Samstag
Die Kirche und ihr Relevanzproblem
Für viele Menschen scheint Kirche keine Relevanz mehr zu haben. Doch liegt das wirklich nur an der Kirchensteuer oder den verheerenden Skandalen? Pfarrer Klaus Künhaupt glaubt, dass das Problem tiefer geht: „Was uns wirklich zunehmend schlecht gelingt, ist eben zu erklären, warum man Religiosität AUCH braucht – als eine weitere Dimension im Leben.“
Ein Beispiel aus seiner Arbeit macht das deutlich: „Ich habe einmal in einer Konfirmandengruppe gesagt: ‚Na ja, diese Frage von Leben und Tod, um die es hier geht, die ist ja vielleicht für euch mit 13 noch nicht so relevant.‘ Und dann sagte eine der KonfirmandInnen: ‚Wie, Leben und Tod?‘ Da sagte ich: ‚Ja, es geht ja um Leben und Tod. Um Leben und Sterben und wie man stirbt und mit welcher Hoffnung man stirbt.‘ Da guckte sie, als ob sie das noch nie gehört habe.“ Für Künhaupt zeigt diese Reaktion, dass viele Menschen nicht mehr verstehen, welche großen, existenziellen Fragen hinter dem Glauben stehen.
Ein großes Problem sieht er in der gesellschaftlichen Verdrängung des Todes: „Unsere Gesellschaft ist so erpicht darauf, alles zu verdrängen, was Krankheit und Tod angeht.“ Künhaupt erlebt immer wieder, wie Menschen völlig hilflos vor dem Tod eines Angehörigen stehen, weil nichts und niemand sie darauf vorbereitet hat. Er erzählt von seinen Beobachtungen: „Die waren noch nie auf einer Beerdigung von einer entfernten Tante oder so. Die gehen da nie mit. Es wird alles von einem ferngehalten.“ Und irgendwann schlägt es dann in ihrer direkten Umgebung zu, wo es sich nicht mehr ignorieren lässt. Dann sind die Menschen völlig unvorbereitet.
Früher, so Künhaupt, hatte die Kirche eine klare Rolle in diesen existenziellen Fragen. Doch heute werde das kaum noch wahrgenommen. „Religion und Christentum haben immer versucht, Menschen auf solche Momente vorzubereiten. Aber das kriegen wir heute schlecht vermittelt.“
Ein weiteres Problem sei, dass viele Menschen falsche Vorstellungen von Kirche hätten. Künhaupt sagt: „Wir müssen anstinken gegen 100 amerikanische Serien, in denen die Leute mitbekommen, dass Christen angeblich gegen die Evolutionslehre sind.“ Dieses Bild würde man dann auch auf die Kirche hier in Deutschland anwenden. Doch er betont, dass das nicht stimmt. Er erklärt, dass Adam und Eva eine metaphorische Geschichte zum Thema ist, wie der Mensch vor Gott steht. „Es geht nicht darum, dass das damals wirklich genauso gewesen ist. So sehen die meisten das in den europäischen Großkirchen, auch die Katholiken.“ Aber trotzdem denken viele: „Christen lehnen Wissenschaft ab.“ Und es sei unheimlich schwer geworden, damit durchzudringen.
Es gibt also eine Mischung aus Unwissen, Distanzierung von existenziellen Fragen und einem Wandel der gesellschaftlichen Werte. Früher war es normal, Mitglied der Kirche zu sein – heute muss sie sich immer wieder aufs Neue erklären.
Trotzdem ist für Künhaupt klar: Die Kirche muss lernen, ihre Botschaft besser zu vermitteln. Sonst werden sich noch mehr Menschen von ihr abwenden – nicht unbedingt aus Ablehnung, sondern weil sie schlicht nicht verstehen, warum sie Kirche in ihrem Leben brauchen könnten.

Werbeplakat für die Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen an der Erlöserkirche in Essen
Warum der Glaube zu den Menschen kommen muss
Die zentrale Frage, die sich die Kirche stellen muss, ist: Wie spricht sie Menschen heute an – besonders diejenigen, die sich von ihr entfernt haben? Künhaupt hat es selbst ausprobiert und verschiedene Wege gesucht, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Einen ersten Versuch startete Künhaupt mit einer Einladung zu einer Zoom-Sitzung für Menschen, die aus der Kirche ausgetreten waren. „Ich wollte wissen, was wir besser machen können.“ Die Reaktionen darauf waren überraschend vielfältig. Viele Leute hätten sehr lange Mails geschrieben. Doch trotz der spannenden Rückmeldungen und interessanten Mailwechseln musste Künhaupt feststellen, dass es nicht so einfach ist, Menschen in den direkten Dialog zu bekommen. „Beim zweiten Mal habe ich einen Kaffeeklatsch für alle Ausgetretenen organisiert. Da ist aber keiner gekommen.“
Wie kann Kirche also sichtbar bleiben? „Wir müssen in den Stadtteilen präsent sein“, sagt Künhaupt. Doch durch den Mitgliederschwund steht die Kirche auch vor finanziellen Herausforderungen. Früher gab es ein großes Gemeindehaus in jedem Viertel. Das geht heute nicht mehr. Die finanziellen Mittel, um all diese Gebäude zu unterhalten, sind nicht mehr vorhanden. „Wir können zwar diese großen Häuser nicht mehr bezahlen, aber wir können trotzdem in den Stadtteilen sein.“
Stattdessen müsse man neue Wege finden. „Vielleicht muss das nicht immer mit einem großen Haus verbunden sein.“ Seine Idee: bei Gastronomen vor Ort, in den Vierteln, in denen es kein Gemeindehaus mehr gibt, anfragen, ob man dort eine Sprechstunde machen könnte. „Ich dachte, vielleicht frage ich mal, ob ich mich zum Beispiel donnerstags von 18 bis 19 Uhr da hinsetzen und sagen kann: ‚Wenn jemand Gesprächsbedarf hat: Ich sitze hier.‘“ Er hofft, dass dann vielleicht auch die Schwellenängste vor so einem Gemeindehaus entfallen.
Auch Gottesdienste müssten sich verändern, um die Menschen zu erreichen. „Viele Leute kommen und sagen: ‚Ihr zieht da immer euren gleichen Gottesdienst durch. Ihr müsst moderne Lieder singen! Ihr müsst auch mal die Leute zu Wort kommen lassen!‘“ erzählt Künhaupt. Deshalb experimentieren er und seine KollegInnen mit neuen Formaten, wie dem „Rastplatz-Gottesdienst“ sonntags um 18 Uhr. Da gibt es Gesprächsrunden und meditative Stille. Die Leute wollen nicht mehr einfach nur zugetextet werden. Dieses Monologische – ein Pfarrer redet und alle hören nur zu – das wollen heute viele nicht mehr. „Die Leute wollen Interaktives.“ Doch wie groß ist das Interesse an solchen neuen Formaten? „Der Zuspruch könnte noch etwas mehr sein“, gibt Künhaupt zu. „Aber wir probieren es jetzt mal.“
Ein weiteres Projekt liegt ihm besonders am Herzen: die Arbeit mit Familien. Die Gemeinde der Erlöserkirche in Essen Holsterhausen möchte wieder mit „Kirche für Kinder“ anfangen. Dafür hat Künhaupt alle Taufeltern aus den letzten drei Jahren angeschrieben und fast alle haben gesagt: „Das wollen wir gerne, da kommen wir hin.“
Künhaupt sieht darin ein Zeichen, dass Menschen sehr wohl Interesse an Gemeinschaft und Glaube haben – sie brauchen nur die richtigen Angebote. „Ich habe den Eindruck, die Leute suchen etwas, was ihr Leben bereichert, in dieser kalten und anonymen Stadt. Sie suchen Gemeinschaft, Sinn, vielleicht auch Religiosität.“
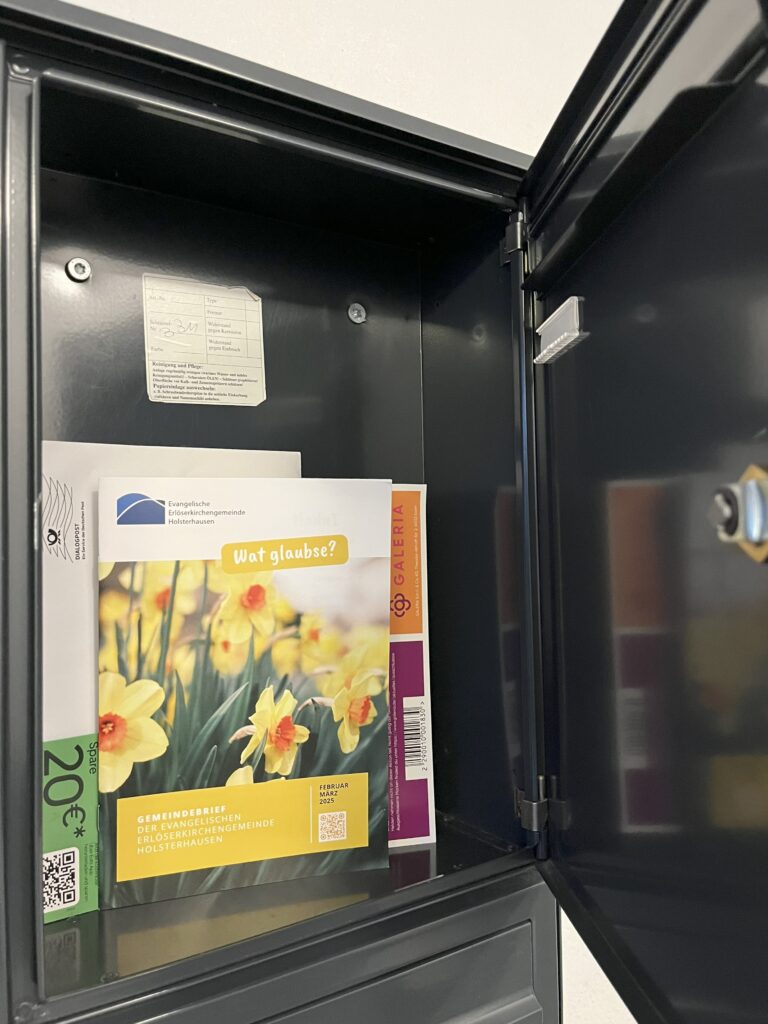
Gemeindebrief der Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen in Essen zwischen Post im Briefkasten
Warum die Kirche neue Kommunikationswege braucht
Ein großes Problem sei, dass die Kirche oft nicht wahrgenommen werde. Obwohl der Gemeindebrief alle zwei Monate verschickt wird, sagen viele von den ausgetretenen Leuten mit denen Künhaupt sprach, dass ihnen das nicht aufgefallen sei. Die alten Wege der Kommunikation funktionieren nicht mehr. Deswegen wurde entschieden, dass Soziale Medien, wie Instagram und TikTok genutzt werden müssen. Doch auch das sei nicht so einfach. Instagram laufe schon ganz gut, aber TikTok? „Ich sehe schon, wenn man 14- bis 15-Jährige erreichen will, kann man auch nichts mehr mit Instagram machen. Das ist auch schon wieder vorbei.“ Aber auch die zwanzigjährigen Mitarbeiterinnen, die sich um den Social Media-Auftritt kümmern, wollen sich nicht an TikTok wagen. Was soll man in fünf Sekunden schon für eine Botschaft überbringen?
Künhaupt ist sich bewusst, dass die Digitalisierung eine Herausforderung ist, aber auch eine Chance. Man müsse in der Sprache der Leute sprechen – aber das ist gar nicht so einfach. Passend merkt er an: „Paulus hat geschrieben, ihr müsst den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude sein. Mit den Juden müsst ihr jüdisch sprechen, mit den Griechen müsst ihr griechisch sprechen, mit den Römern römisch. Mit der heutigen Gesellschaft muss man in ihrer Sprache sprechen. Und nicht dauernd eine Sprache sprechen, die nur wir verstehen.“
Ein Beispiel aus seiner Arbeit zeigt, wie digitale Kommunikation helfen kann: Er hat bei Taufen die Handynummern der Eltern notiert. Wenn er ihnen später mal schnell eine WhatsApp schreibt, kommt da direkt eine Antwort. Ein Brief? Der geht oft unter.
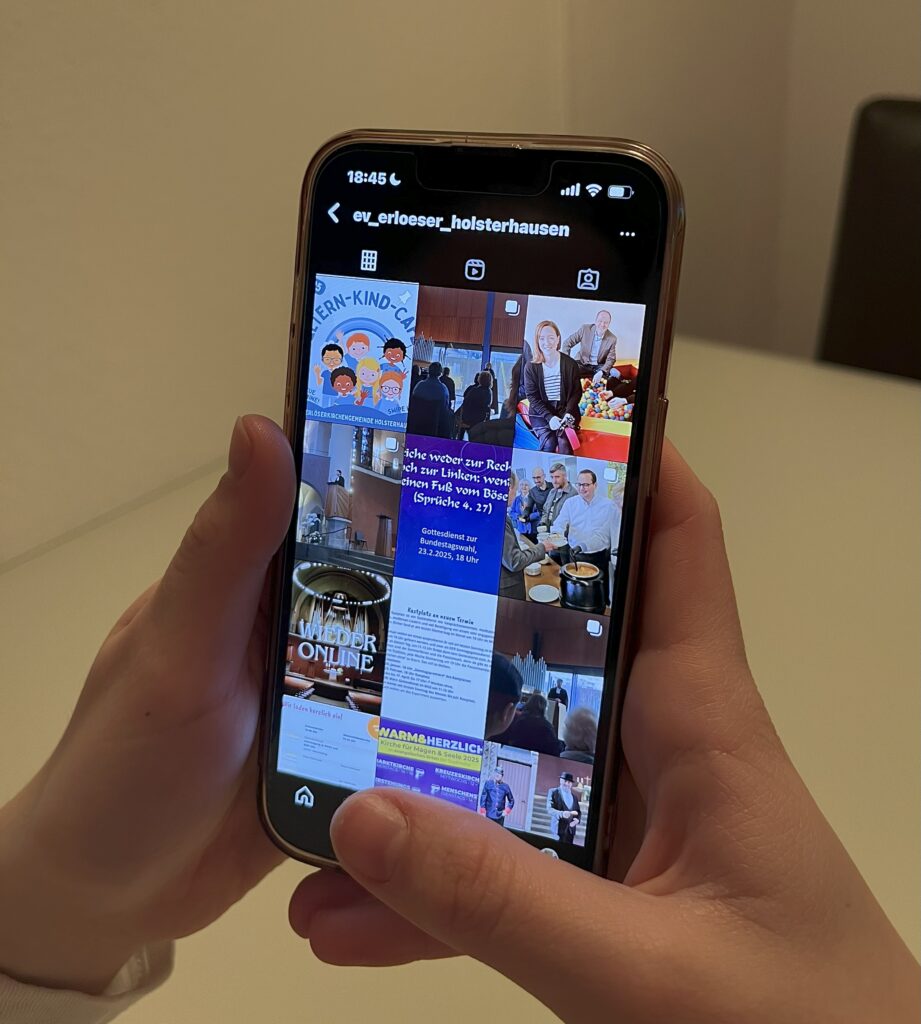
Instagram-Profil der Erlöserkirchengemeinde Holsterhausen in Essen auf einem Handy geöffnet
Strukturelle Probleme als Bremsklotz
Neben all diesen Ansätzen gibt es aber ein großes Problem, das alles erschwert: Die Kirche ist stark mit sich selbst beschäftigt. Künhaupt erklärt: „Wir kommen aus einer Zeit, in der 80 Prozent der deutschen Bevölkerung Kirchensteuer gezahlt haben. Da konnten wir Strukturen aufbauen – Gemeindezentren, Kitas, Kirchen direkt nebeneinander.“ Wo früher noch in jeder Kirche drei bis vier Pfarrer waren sind es heute nur noch einer für die gesamte Gemeinde.

Kircheninnenraum der Erlöserkirche in Essen aus Sicht des Altars
Doch diese Zeit sei vorbei. Heute könne man sich das nicht mehr leisten. Gebäude müssen schließen, Personal reduziert werden. Und das kostet viel Energie. „Man kommt kaum noch dazu, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, was ist denn mit euch, weil man so sehr mit seinen eigenen Strukturprozessen beschäftigt ist.“
Trotz aller Herausforderungen bleibt Künhaupt optimistisch. Für ihn steht fest: Die Kirche muss flexibler werden, neue Formate testen und die digitalen Möglichkeiten besser nutzen – ohne dabei das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: Kirche bedeutet Gemeinschaft. Und Gemeinschaft muss man erleben. Auch in Zukunft müsse man den Menschen diesen Raum bieten.
Chancen für eine moderne Kirche
Künhaupt blickt mit vorsichtigem Optimismus auf die kommenden Jahre. Er hofft, dass sich die Mitgliederzahlen auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren werden, was der Kirche eine Chance zur Neuausrichtung bietet. „Bis dahin werden noch viele Häuser schließen, aber wir müssen uns auch neu erfinden.“ Dabei sieht er nicht nur Herausforderungen, sondern auch eine Möglichkeit, das kirchliche Profil zu schärfen. „Vielleicht hilft es uns sogar, uns endlich von vielem Alten zu lösen, an dem wir so lange festgehalten haben, während die Leute das gar nicht mehr abfragen.“
Er hofft auf eine Kirche, die sich nicht mehr mit überkommenen Strukturen belastet, sondern flexibel auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Reformen, die heute noch undenkbar erscheinen, hält er für dringend notwendig – sowohl in der Verwaltung als auch in der inhaltlichen Ausrichtung. Zentral seien die Fragen: „Was erwarten die Menschen heute wirklich von uns? Und wie können wir das mit unserer Botschaft verbinden?“
Letztlich wird die Zukunft der Kirche nicht allein durch Gebäude oder Mitgliederzahlen bestimmt, sondern durch ihre Fähigkeit, gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und eine relevante Rolle im Leben der Menschen zu spielen. Es geht nicht darum, vergangene Zeiten zurückzuholen, sondern neue Wege zu finden – mit einer Kirche, die weniger auf Strukturen beharrt, sondern mutig vorangeht, um die Gemeinschaft zu stärken und für die Menschen da zu sein.

Treppenaufgang zur Empore der Erlöserkirche in Essen
Das Copyright der Bilder liegt bei der Autorin.

